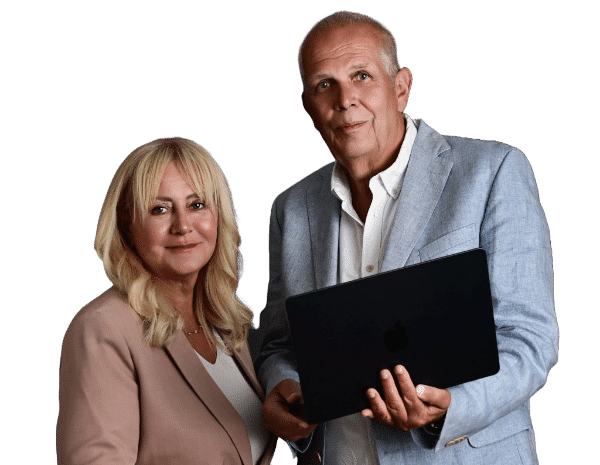Am 11. Juli 2025 veröffentlichte das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig eine wegweisende Entscheidung zum Thema Diebstahl von Bitcoin. Die Entscheidung stieß sowohl in juristischen Fachkreisen als auch in der Öffentlichkeit auf großes Interesse, da sie sich mit der strafrechtlichen Einordnung digitaler Vermögenswerte auseinandersetzt und grundlegende Fragen zur rechtlichen Behandlung von Kryptowährungen im deutschen Recht aufgreift. Im Folgenden werden die Hintergründe des Falls, die zentralen rechtlichen Streitfragen, die Begründung des Gerichts sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der Entscheidung ausführlich dargestellt.
Hintergrund des Falls
Im Zentrum des Falls stand der Diebstahl einer erheblichen Menge Bitcoin durch einen ehemaligen Mitarbeitenden einer auf Kryptowährungen spezialisierten IT-Firma mit Sitz in Niedersachsen. Der oder die Beschuldigte hatte sich unter Umgehung von Sicherheitsmechanismen Zugang zu digitalen Wallets des Unternehmens verschafft und insgesamt 7,3 Bitcoin auf eine eigene Adresse transferiert. Der Vorfall wurde im Frühjahr 2024 entdeckt, woraufhin das Unternehmen Strafanzeige erstattete.
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft stießen bereits früh auf die zentrale Rechtsfrage, ob und inwieweit der Diebstahl von Bitcoin unter den Diebstahlstatbestand nach § 242 StGB fällt. Während Sachverständige und Jurist*innen sich uneinig zeigten, ob Bitcoin als „Sache“ im Sinne des Strafgesetzbuches anzusehen ist, musste das OLG Braunschweig im Rahmen der Revision eine grundsätzliche Klärung vornehmen.
Juristische Kernfragen
Das deutsche Strafrecht sieht den Diebstahl nach § 242 StGB nur dann als erfüllt an, wenn jemand einer anderen Person eine „fremde bewegliche Sache“ wegnimmt, um sich oder einem Dritten diese rechtswidrig zuzueignen. Die zentrale Streitfrage lautet daher:
- Sind Bitcoin im strafrechtlichen Sinne als „Sache“ einzustufen?
- Wie ist eine Wegnahme im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu verstehen?
- Kommt eine Strafbarkeit ggf. nach anderen Vorschriften (z. B. Computerbetrug gemäß § 263a StGB) in Betracht?
Die rechtliche Einordnung von Bitcoin
Bitcoin sind digitale, dezentral verwaltete Einheiten, die ausschließlich aus Daten bestehen. Sie existieren nicht körperlich und sind daher im zivilrechtlichen Sinne keine Sachen (§ 90 BGB). Dennoch werden sie als Vermögenswerte gehandelt und besitzen einen erheblichen wirtschaftlichen Wert. Die juristische Debatte, ob und wie Bitcoin unter bestehendem Recht zu fassen sind, ist seit Jahren Gegenstand intensiver Diskussionen.
Die Entscheidung des OLG Braunschweig
Das OLG Braunschweig entschied am 11. Juli 2025, dass Bitcoin nicht als „Sache“ im Sinne des § 242 StGB zu qualifizieren sind. Der Diebstahlstatbestand setze voraus, dass der Gegenstand körperlich vorhanden sei und einer tatsächlichen Wegnahme im Sinne des Gewahrsamsbruchs zugänglich sei. Da Bitcoin jedoch lediglich aus einer Abfolge von Daten bestehen und keine körperliche Existenz aufweisen, fehle es am Tatbestandsmerkmal der Sache.
Wesentliche Begründungspunkte des Gerichts:
- Bitcoin sind keine körperlichen Gegenstände, sondern Daten.
- Die Definition der „Sache“ im Strafrecht erfordert eine physische Existenz.
- Die Übertragung von Bitcoin bedeutet keinen Bruch von Gewahrsam an einer Sache, sondern die Änderung der Verfügungsmacht über eine digitale Information.
- Eine Analogie zur Sachdefinition sei aufgrund des strafrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatzes (Art. 103 Abs. 2 GG) unzulässig.
Das Gericht stellte jedoch ausdrücklich klar, dass der Entzug von Bitcoin zwar nicht als Diebstahl im Sinne des § 242 StGB, wohl aber als Computerbetrug gemäß § 263a StGB strafbar sein könne, sofern eine Täuschungshandlung oder Manipulation elektronischer Daten zur Erlangung der Bitcoin vorliegt.
Abgrenzung zu anderen Straftatbeständen
Das OLG Braunschweig betonte, dass trotz der Ablehnung des Diebstahlstatbestandes der Zugriff auf fremde Bitcoin in strafrechtlicher Hinsicht sehr wohl relevant ist:
- Computerbetrug (§ 263a StGB): Wer eine Täuschung oder Manipulation von Daten vornimmt, um sich Bitcoin zu verschaffen, kann sich wegen Computerbetrugs strafbar machen.
- Datenveränderung (§ 303a StGB): Das unbefugte Verändern gespeicherter Daten kann ebenfalls strafbar sein.
- Unbefugter Zugriff auf Computersysteme (§ 202a StGB): Das Ausspähen fremder Zugangsdaten oder Wallets ist ebenfalls unter Strafe gestellt.
Insgesamt bestätigte das Gericht, dass Bitcoin-Diebstähle keineswegs im „rechtsfreien Raum“ stattfinden, auch wenn die klassische Diebstahlsnorm nicht greift.
Reaktionen und Bedeutung für die Praxis
Die Entscheidung des OLG Braunschweig löste ein breites Echo aus:
- Juristische Fachkreise begrüßten die Klarstellung, mahnten jedoch eine schnelle Anpassung der Gesetzgebung an die Realität digitaler Vermögenswerte an.
- IT-Sicherheitsexpert*innen und Unternehmen sehen den dringenden Bedarf, den strafrechtlichen Schutz digitaler Assets auszuweiten.
- In Politik und Verwaltung wurden Forderungen nach einer Reform des Strafgesetzbuches laut, um Kryptowährungen ausdrücklich in die Tatbestände einzubeziehen.
Kritiker*innen befürchten, dass Kriminelle die Entscheidung als Einladung zum Diebstahl digitaler Vermögenswerte
Vergleich mit der Rechtslage im Ausland
Auch international gibt es unterschiedliche Ansätze zur strafrechtlichen Behandlung von Kryptowährungen:
- In den USA wurden Bitcoins in einigen Gerichtsentscheidungen als „property“ anerkannt, was einen Diebstahlstatbestand ermöglicht.
- Auch in Großbritannien tendiert die Rechtsprechung dazu, digitale Vermögenswerte unter Eigentumsdelikte zu fassen.
- Im deutschsprachigen Raum dominiert bislang die restriktive Auslegung, wie sie das OLG Braunschweig bestätigt hat.
Wie geht es weiter?
Die Entscheidung des OLG Braunschweig vom 11. Juli 2025 markiert einen wichtigen Schritt in der juristischen Auseinandersetzung mit digitalen Vermögenswerten. Sie zeigt die Grenzen des bestehenden Strafrechts auf und betont die Notwendigkeit, die gesetzlichen Tatbestände an die Erfordernisse des digitalen Zeitalters anzupassen. Ob der Gesetzgeber kurzfristig reagieren wird, bleibt abzuwarten. In jedem Fall wird der Schutz digitaler Güter und die Bekämpfung von Cyberkriminalität weiterhin ein zentrales Thema der Rechtspolitik bleiben.
Muss ich mir Sorgen machen?
Hierzu gibt es eine klare Antwort: Ja!
Der Grundsatz der Eigenverantwortung bleibt unverändert bestehen; sie kann nicht übertragen werden und sollte stets wahrgenommen werden. Insgesamt lässt sich der beschriebene Vorgang auch als ein Bequemlichkeitsurteil charakterisieren. Die Zahl der Fälle von Cyberbetrug im Zusammenhang mit Krypto-Assets nimmt stetig zu, jedoch bleiben aufgrund begrenzter personeller Kapazitäten und fehlender Qualifikationen viele dieser Verfahren unbearbeitet und werden häufig eingestellt.
Mit seiner Entscheidung zum Bitcoin-Diebstahl hat das OLG Braunschweig wichtige Klarstellungen zur strafrechtlichen Einordnung digitaler Vermögenswerte getroffen. Zwar sind Bitcoin keine Sachen im Sinne des § 242 StGB und damit nicht Gegenstand eines klassischen Diebstahls, jedoch ist der unbefugte Zugriff auf Bitcoin nach anderen strafrechtlichen Vorschriften durchaus sanktionierbar. Die Entscheidung unterstreicht den Handlungsbedarf für den Gesetzgeber und hat damit Signalwirkung weit über den Einzelfall hinaus.
Gegen Entscheidungen des Oberlandesgerichts (OLG) Braunschweig sind in der Regel Rechtsmittel wie Revision oder Rechtsbeschwerde möglich, abhängig von der Art des Verfahrens und der getroffenen Entscheidung. Die genauen Rechtsmittel und deren Zulässigkeit richten sich nach den einschlägigen Gesetzen, wie der Zivilprozessordnung (ZPO), der Strafprozessordnung (StPO).
Es bleibt somit abzuwarten, wie die weitere Rechtssprechung aussehen wird. Einige renomierte Juristen haben starke Zweifel an der Position des OLG Braunschweigs.